Sprache
Soll ich mich gegen Corona impfen lassen?
Es gibt eine Impfung gegen das Corona-Virus.
Trotzdem sind viele Menschen unsicher.
Sie fragen sich:
Soll ich mich impfen lassen oder nicht?
Hier lesen Sie,
was bei einer Impfung im Körper passiert.
Warum ist das Corona-Virus gefährlich?
Seit einigen Jahren gibt es das Corona-Virus.
Man spricht es so aus: Ko-ro-na-wi-rus.
Das Corona-Virus kann krank machen.
Die Krankheit heißt COVID-19.
Sie ist sehr ansteckend.
Viele Menschen sind
durch COVID-19 krank geworden.
Einige Menschen mussten ins Krankenhaus.
Manche Menschen sind an COVID-19 gestorben.
Lange konnten wir wenig gegen die Krankheit tun.
Es gab keine guten Medikamente.
Und keine Impfung.
Darum haben viele Experten geforscht.
Das heißt:
Sie haben viele Sachen ausprobiert.
Die Experten haben einen Impf-Stoff gesucht.
Und haben sogar
mehrere Impf-Stoffe gefunden.
Trotzdem sind viele Menschen unsicher.
Sie fragen sich:
Soll ich mich impfen lassen oder nicht?
Muss ich mich immer wieder impfen lassen?
Hier lesen Sie,
was bei einer Impfung im Körper passiert.
Wie wehrt sich der Körper gegen ein Virus?

Unser Körper wehrt sich ständig
gegen Krankheits-Erreger.
Das können zum Beispiel
Viren oder Bakterien sein.
Trotzdem können Krankheits-Erreger
in den Körper kommen.
Davon kann man krank werden.
Dann reagiert unser Immun-System.
Das Immun-System ist
die Gesundheits-Polizei im Körper.
Das Immun-System
kann Krankheits-Erreger angreifen.
Damit wir wieder gesund werden.
Der Vorteil:
Das Immun-System hat ein Gedächtnis.
Das heißt:
Das Immun-System merkt sich
jeden Krankheits-Erreger.
Manche Krankheits-Erreger
greifen den Körper mehrmals an.
Schon beim zweiten Mal kann das Immun-System die Krankheits-Erreger besser bekämpfen.
Deshalb werden wir dann nicht mehr krank.
Das liegt an den Anti-Körpern.
Das sind Abwehr-Stoffe.
Der Körper bildet sie gegen Krankheits-Erreger.
Das Immun-System ist also lebens-wichtig.
Es schützt unseren Körper vor Krankheiten.
Was passiert bei einer Impfung im Körper?
Der Körper bildet Abwehr-Stoffe gegen Krankheits-Erreger.
So kann der Krankheits-Erreger bekämpft werden.
Wichtig ist:
Der Körper merkt sich jeden Krankheits-Erreger.
Darum funktionieren auch Impfungen.
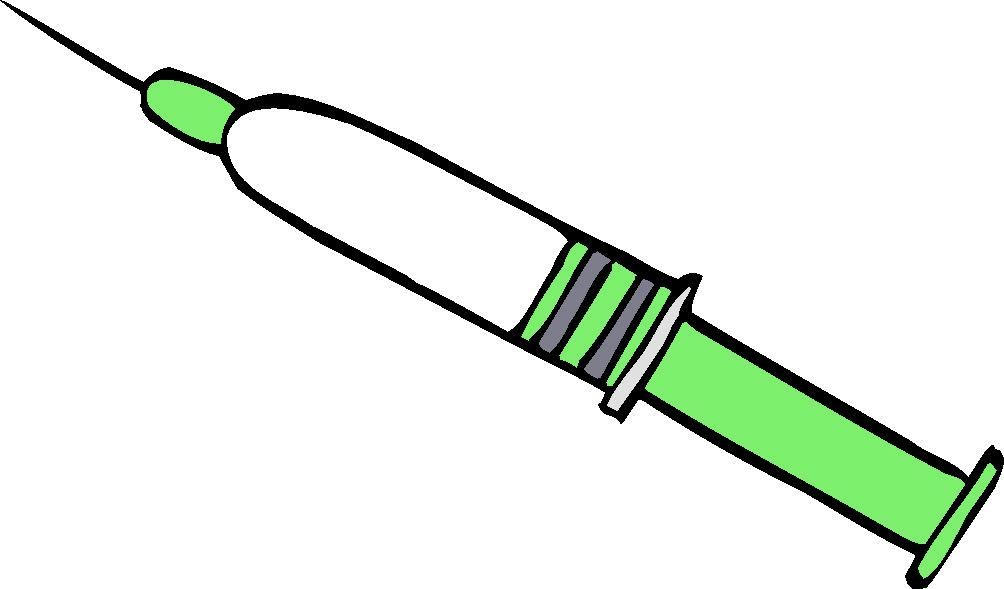
Ein Impf-Stoff enthält zum Beispiel
getötete Krankheits-Erreger.
Sie werden einem Menschen
zum Beispiel gespritzt.
Dann bildet der Körper Abwehr-Stoffe
gegen den Krankheits-Erreger.
Die Abwehr-Stoffe schützen den Menschen.
Das heißt:
Der Körper kann sich schneller wehren.
Wenn der Krankheits-Erreger
später in den Körper eindringt.
Der Mensch wird dann gar nicht oder nur ein bisschen krank.
Ab wann wirkt eine Impfung? Wie lange hält die Wirkung an?
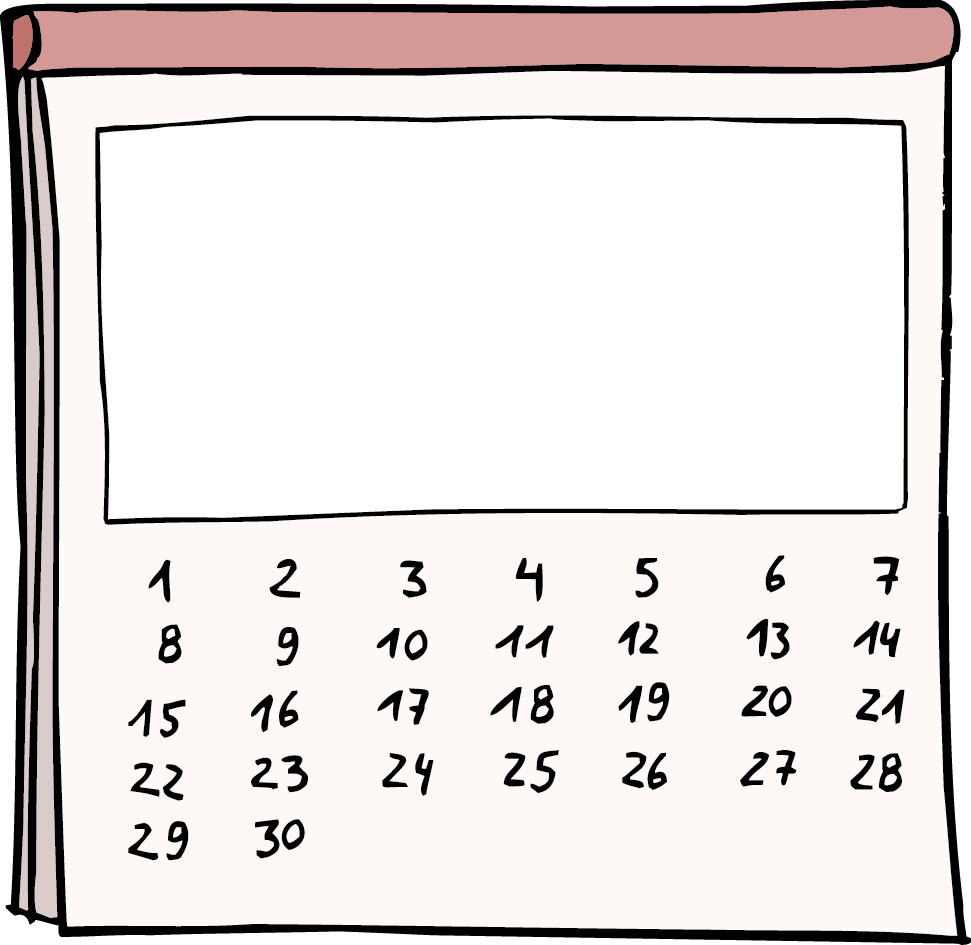
Es gibt verschiedene Impf-Stoffe.
Die meisten Impf-Stoffe
wirken erst nach einigen Wochen.
Manchmal sind auch mehrere Impfungen nötig.
Und zwar mit dem gleichen Impf-Stoff.
Einige Impfungen schützen ein Leben lang.
Andere Impfungen müssen
nach einigen Jahren wiederholt werden.
Danach ist der Körper dann längere Zeit
oder für immer geschützt.
Dazu sagt man auch:
Die Impfung muss aufgefrischt werden.
Manche Krankheits-Erreger verändern sich auch.
Zum Beispiel die Erreger der Grippe.
Gegen die Grippe muss man sich darum jedes Jahr neu impfen lassen.
Es gibt verschiedene Impf-Stoffe. Was ist der Unterschied?
Impfungen sollen Menschen vor Krankheiten schützen.
Impfungen können unterschiedlich funktionieren:
Die aktive Impfung
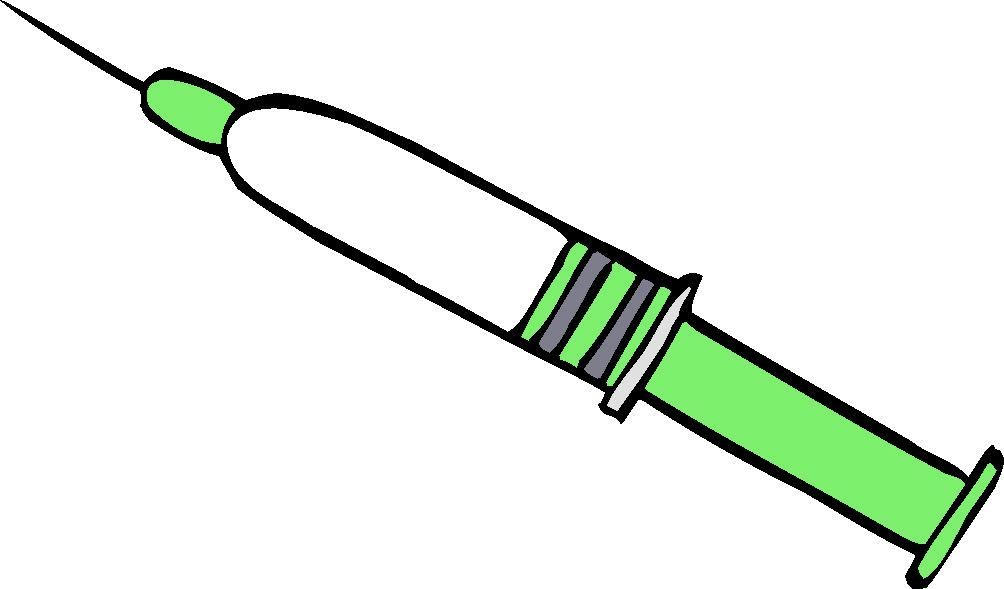
Das bedeutet:
Ein Mensch bekommt zum Beispiel
einen Krankheits-Erreger gespritzt.
Sein Körper bildet Abwehr-Stoffe
gegen den Krankheits-Erreger.
Die Abwehr-Stoffe
schützen den Menschen vor der Krankheit.
Die Krankheits-Erreger können tot
oder lebendig sein.
Was ist ein Tot-Impfstoff?
Das bedeutet: Der Krankheits-Erreger wurde abgetötet.
Er kann sich im Körper nicht mehr vermehren.
Trotzdem wirkt die Impfung.
Was ist ein Lebend-Impfstoff?
Das bedeutet: Die Krankheits-Erreger leben.
Aber sie wurden geschwächt.
Sie selbst können die Krankheit darum nicht auslösen.
Trotzdem kann der Körper Abwehr-Stoffe gegen den Krankheits-Erreger bilden.
Die passive Impfung
Das bedeutet:
Ein Mensch bekommt gleich Abwehr-Stoffe gespritzt.
Sie können direkt wirken.
Der Körper muss die Abwehr-Stoffe nicht mehr selbst machen.
Manchmal hat ein Mensch sich vielleicht schon mit einem Krankheits-Erreger angesteckt.
Dann ist diese Impfung gut.
Passive Impfungen sind aber selten.
Was sind mRNA-Impfstoffe?

mRNA spricht man so: EM-ER-EN-A
mRNA ist die Abkürzung für:
Boten-Ribo-Nuklein-Säure.
mRNA transportiert wichtige Informationen.
Zum Beispiel den Bau-Plan vom Corona-Virus.
Bei der mRNA-Impfung wird einem Menschen ein
kleiner Teil von diesem Corona-Bau-Plan gespritzt.
Mit diesem Bau-Plan kann der Körper
ein bisschen vom Corona-Virus selbst herstellen.
Zum Beispiel das Spike-Protein.
Das spricht man so: Speik-Prote-Ihn.
Das ist auf der Ober-Fläche vom Corona-Virus.
Das Spike-Protein wird auf Bildern
oft als Stacheln gezeigt.
Durch die Impfung stellt der Körper das Spike-Protein selbst her.
Das Spike-Protein ist nicht gefährlich.
Trotzdem kann der Körper Abwehr-Stoffe dagegen bilden.
Die Abwehr-Stoffe schützen den Körper dann vor dem Corona-Virus.
Was sind Vektor-Impfstoffe?
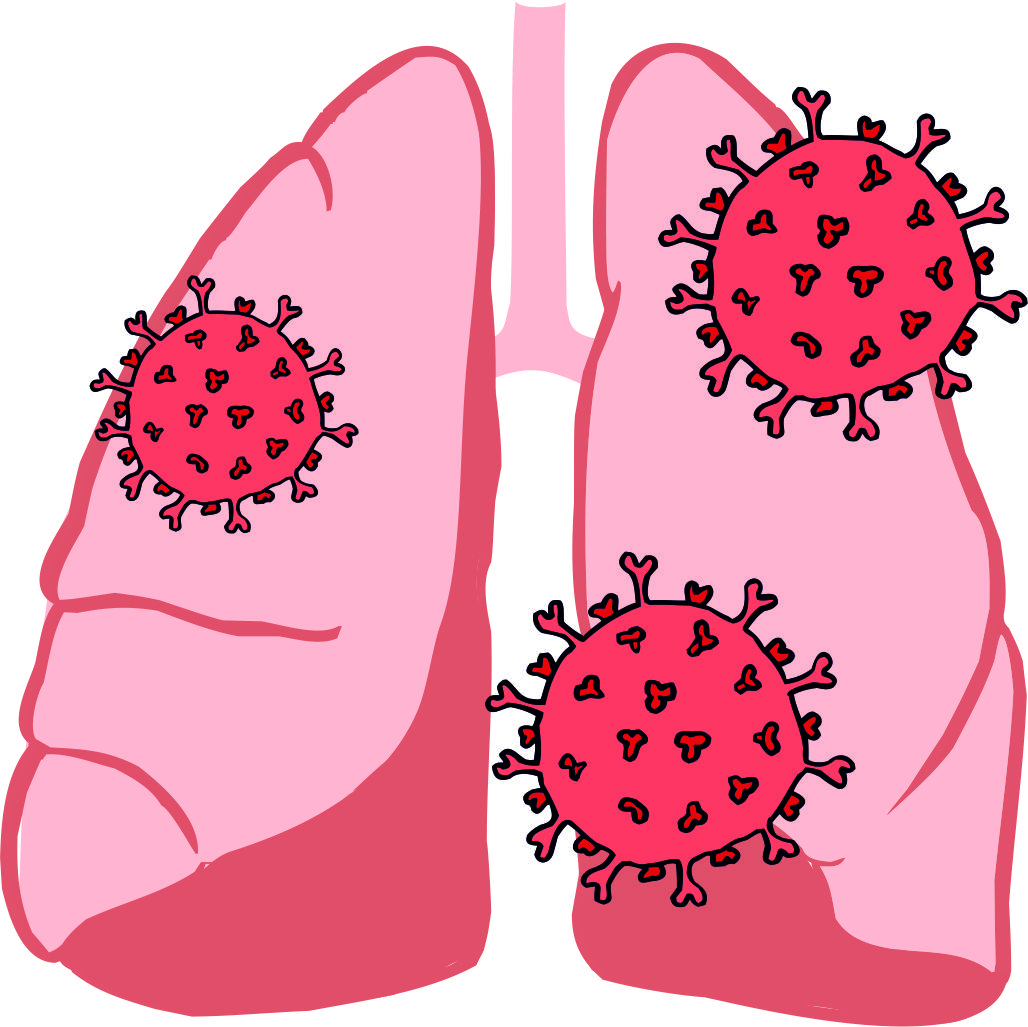
Das Wort Vektor ist lateinisch.
Es heißt: Träger oder Fahrer.
In einem Vektor-Impfstoff steckt ein Virus.
Durch das Virus können Menschen
eine Erkältung bekommen.
Das Virus ist nicht gefährlich.
Es kann sich im Körper nicht vermehren.
Aber das Virus ist wirklich eine Art Fahrer.
Es transportiert den Bau-Plan
für einen Teil vom Corona-Virus.
Dieser Teil ist das Spike-Protein.
Zur Erinnerung:
Das spricht man so: Speik-Prote-Ihn.
Es ist auf der Ober-Fläche vom Corona-Virus.
Das Spike-Protein wird auf Bildern
oft als Stacheln gezeigt.
Das Spike-Protein ist nicht gefährlich.
Mit dem Bau-Plan kann der Körper das Spike-Protein selbst herstellen.
Die Spike-Proteine werden dann vom Immun-System erkannt.
Und das Immun-System merkt: Die gehören hier nicht hin.
Darum bildet das Immun-System Abwehr-Stoffe gegen das Spike-Protein.
Die Abwehr-Stoffe schützen den Körper dann auch vor dem Corona-Virus.
Hat eine Impfung Neben-Wirkungen?
Eine Impfung kann Neben-Wirkungen haben.
Das ist normal.
Neben-Wirkungen zeigen:
Das Immun-System arbeitet.
Meistens sind Neben-Wirkungen nicht gefährlich.
Das können Neben-Wirkungen sein:
- Rötungen, Schwellungen oder Schmerzen an der Impf-Stelle.
- Auch Fieber, Kopf- und Glieder-Schmerzen oder Unwohlsein sind möglich.
Die Neben-Wirkungen gehen aber oft nach wenigen Tagen wieder weg.
Schlimmere Neben-Wirkungen müssen immer gemeldet werden.
Kann ich trotz einer Impfung krank werden?
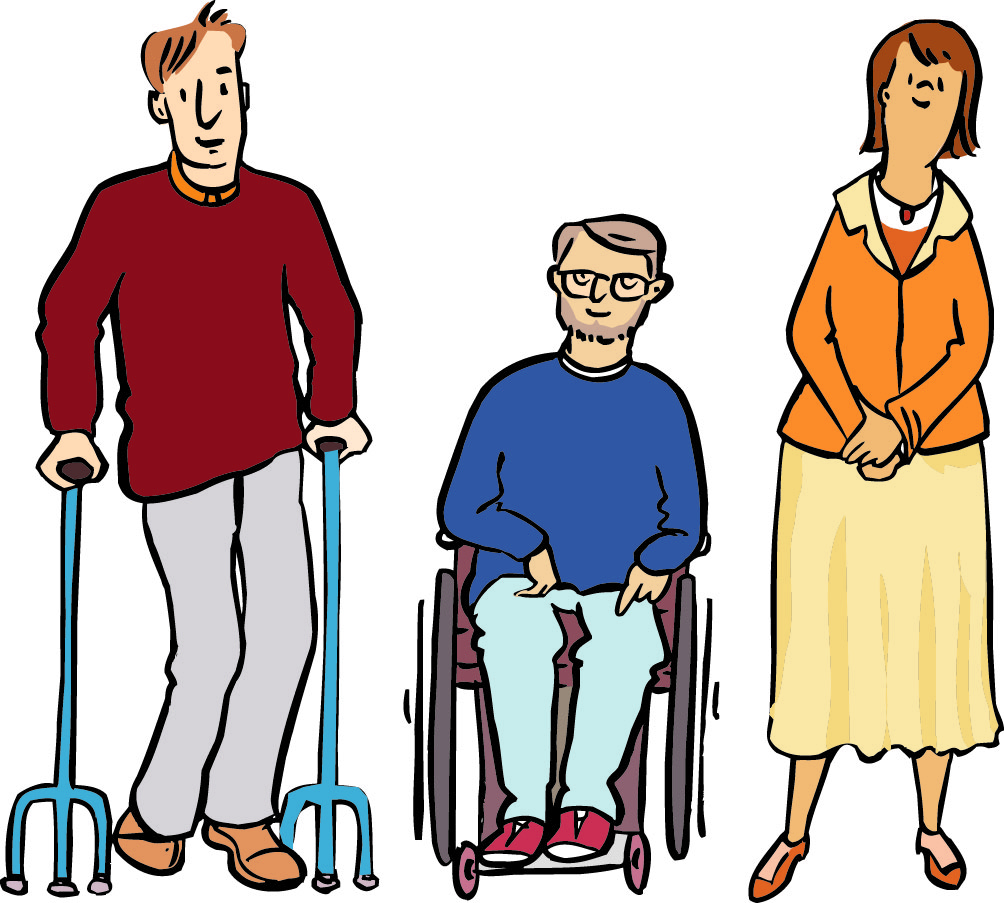
Impfungen schützen vor vielen Krankheiten.
Aber es gibt Ausnahmen.
Manchmal wirken Impfungen auch nicht.
Oder nicht so gut.
Das hängt von verschiedenen Sachen ab.
Zum Beispiel:
- vom Alter vom Menschen,
- ob es ein Mann oder eine Frau ist,
- ob er oder sie noch andere Krankheiten hat.
Warum ist Impfen wichtig?

Es gibt viele schwere Krankheiten.
Früher sind zum Beispiel
viele Menschen an der Diphterie gestorben.
Diphterie spricht man so: Difterie.
Durch Diphterie kann man zum Beispiel ersticken.
Heute kennen viele Menschen
die Krankheit gar nicht mehr.
Weil es eine Impfung gegen Diphterie gibt.
Auch eine Grippe kann Menschen
sehr krank machen.
Eine Impfung schützt davor.
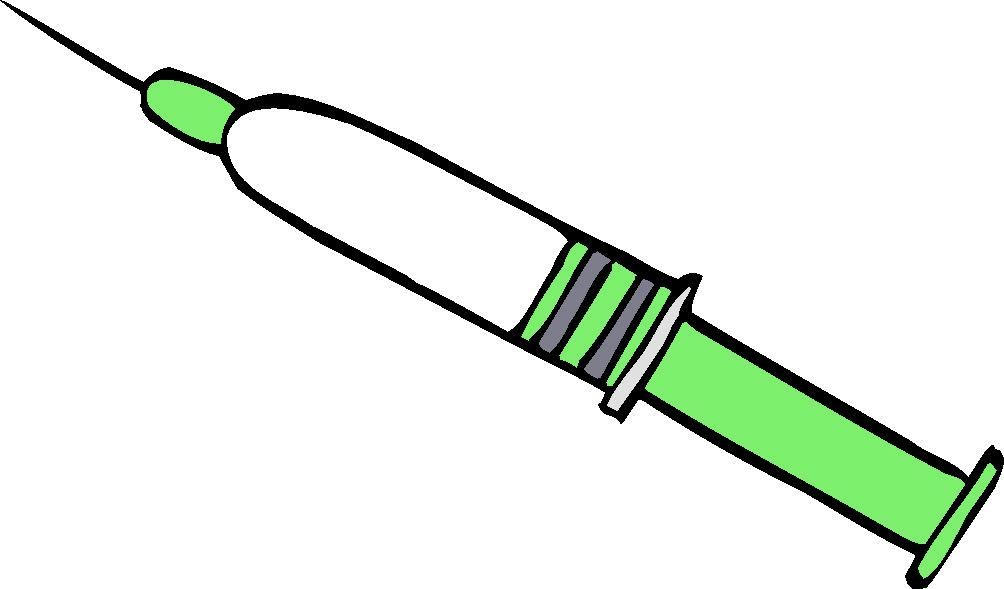
Gegen das Corona-Virus gibt es eine Impfung.
Damit ist man besser vor
dem Corona-Virus geschützt.
Viele Menschen sind schon mehrmals geimpft.
Und können sich noch öfter impfen lassen.
Dazu sagt man auch:
Die Impfung wird aufgefrischt.
Der Imfp-Stoff wird immer wieder angepasst.
Weil sich auch die Corona-Viren verändern.
So eine Auffrischung ist besonders für ältere Menschen wichtig.
Und für Menschen mit Krankheiten.
Hier gibt es mehr Informationen zum Impfen
- Film mit Infos zur Corona-Impfung in Leichter Sprache und in Gebärdensprache. Der Film ist von der reha gmbh. Das spricht man so: ge-em-be-ha.
- Corona-Impfung: Was ist das? Informationen in Leichter Sprache aus der Zeitung Das Parlament.
- Impfung gegen COVID-19: Erklärung für die Formulare in Leichter Sprache Informationen vom Robert Koch Institut.
- Diese Fragen stellt der Arzt vor der Corona-Impfung Informationen vom Robert Koch Institut.
- Informationen über die Corona-Impfung in Leichter Sprache Ein Merk-Blatt vom Robert Koch Institut.
