Widerspruch einlegen: Über Widersprüche gegen Bescheide
Eine Leistung wird beantragt und abgelehnt. Nach der Enttäuschung über den Bescheid stellt sich die Frage, ob ein Widerspruch etwas ändern könnte. Hier erklären wir, wie Sie einen Widerspruch schreiben, ihn richtig einlegen und worauf Sie achten müssen.
Beispiel 1: A, mit dem Pflegegrad 3, hat eine sogenannte geistige Behinderung. Sein Antrag auf Bewilligung von Leistungen der Eingliederungshilfe wird abgelehnt. Die Ablehnung wird damit begründet, dass er zunächst die Leistungen der Pflege nutzen soll. Dagegen möchte A Widerspruch einlegen. Hierzu hat er einige Fragen.
Beispiel 2: A ist unsicher, ob er den Widerspruch begründen muss und ob er sich dabei ggf. von einem Anwalt helfen lassen kann – wer trägt dann die Kosten für den Anwalt?
Beispiel 3: Nachdem A Widerspruch eingelegt hat, wartet er monatelang auf eine Antwort, aber nichts passiert. Nun möchte er wissen, wie es weitergeht.
Wer kann Widerspruch einlegen?

Frage zu Beispiel 1: A möchte wissen, ob sein gesetzlicher Betreuer den Widerspruch unterschreiben muss – oder ob er ihn selbst wirksam unterschreiben kann.
Antwort: Ja, den Widerspruch kann A selbst unterschreiben. Eine Ausnahme wäre es, wenn A geschäftsunfähig ist. In diesem Fall könnte sein gesetzlicher Betreuer (oder bei Minderjährigen die Eltern) den Widerspruch für ihn einlegen. Betreuer oder Eltern handeln dann also als Vertreter.
Hinweis: Es gibt zwar die Meinung, dass der Widerspruch nicht unterschrieben werden muss. Sicherheitshalber sollten Sie aber unterschreiben. Sie können auch eine andere Person bitten, für Sie Widerspruch einzulegen. Dann sollte dem Widerspruch eine schriftliche Vollmacht von Ihnen beigefügt werden.
Wo wird Widerspruch eingelegt?
Der Widerspruch ist bei der Stelle einzulegen, die den Bescheid erlassen hat.
Zu Beispiel 1: A muss daher in seinem Fall den Widerspruch bei dem Träger der Eingliederungshilfe einlegen, der den Ablehnungsbescheid erlassen hat. Die Stelle, wo der Widerspruch hingeschickt / abgegeben (bzw. "eingelegt") werden muss, steht auf dem ablehnenden Bescheid (am Ende des Bescheids unter Rechtsmittelbelehrung).
Wie wird Widerspruch eingelegt?
Zu Beispiel 1: A fragt sich, ob er den Widerspruch per E-Mail versenden oder alternativ bei der Behörde anrufen und telefonisch Widerspruch einlegen kann.
Antwort: Widerspruch per Mail einzulegen, ist in den allermeisten Fällen nicht zulässig (dazu unten mehr). Auch eine telefonische Widerspruchseinlegung ist nicht zu empfehlen. Wir raten deshalb davon ab, bei der Behörde telefonisch oder via E-Mail zu widersprechen.
So kann Widerspruch eingelegt werden (§ 84 Sozialgerichtsgesetz / SGG)
Der Widerspruch wird Schriftlich (eigenhändig unterzeichnet) und z. B. per Fax, als Einschreiben mit Rückschein oder persönlich bei der Widerspruchsstelle abgegeben.
Im Gesetz ist geregelt, dass es für das Versenden per Mail eine qualifizierende elektronische Signatur braucht, die die meisten Menschen nicht haben. Daher scheidet eine Widerspruchseinlegung per Mail regelmäßig aus!
Schriftformersetzend nach § 36a Abs. 2a SGB I und § 9a Abs. 5 Onlinezugangsgesetz.
Zur Niederschrift vor Ort bei der Stelle, die den Verwaltungsakt erlassen hat. Das bedeutet: Sie gehen dorthin und teilen mit, dass Sie Widerspruch einlegen möchten. Sie müssen Ihre Identität nachweisen und ggf. eine Vollmacht vorlegen (falls Sie für eine andere Person den Widerspruch einlegen möchten).
Hinweis: Die Behörde darf Sie nicht auf die schriftliche Widerspruchseinlegung verweisen, lassen Sie sich also deswegen bitte nicht wegschicken! Über die Widerspruchseinlegung muss die Behörde ein Protokoll anfertigen.
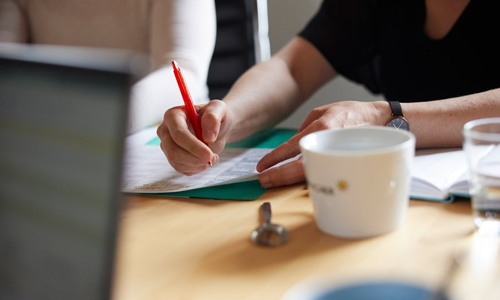
Wichtig ist, dass man einen Nachweis für das Versenden des Widerspruchs hat:
- Einen positiven Sendebericht des Faxgeräts.
- Einen Einschreibebeleg.
- Einen Zeugen dafür, dass man einen Widerspruch gegen einen bestimmten Bescheid (Aktenzeichen) geschrieben, in den Briefumschlag gesteckt und an einem bestimmten Tag (Datum und Uhrzeit) in den Briefkasten geworfen oder persönlich abgegeben hat. Am besten ein Handy-Foto vom Widerspruch machen, was aber nicht das fristgerechte Einwerfen in den Behörden-Briefkasten beweist!
Wenn Sie den Widerspruch persönlich abgeben, sollten Sie sich auf einer Kopie den Empfang des Widerspruchs vom Sachbearbeiter schriftlich bestätigen lassen (inklusive Datum!). Damit wird bestätigt, dass der Widerspruch innerhalb der Widerspruchsfrist eingegangen ist.
Haben Sie Widerspruch per Post eingelegt, sollten Sie ein paar Tage später bei der Behörde anrufen: Lassen Sie sich den Eingang des Widerspruchs bestätigen. Lassen Sie sich auch bestätigen, wann dieser bei der Behörde angekommen ist (Namen der Person notieren, mit der Sie gesprochen haben, sowie das Datum des Telefonats!).
Wie lange kann ich gegen eine Ablehnung Widerspruch einlegen?
Wichtig: Der Widerspruch muss innerhalb von einem Monat nach der Bekanntgabe des Bescheids bei der Behörde angekommen sein (§ 84 Sozialgerichtsgesetz / SGG). In seltenen Fällen beträgt die Widerspruchsfrist ein Jahr. Das ist aber nur dann der Fall, wenn der Bescheid ausnahmsweise keine oder eine fehlerhafte Rechtsmittelbelehrung enthält (§ 66 Abs. 2 SGG).
Es reicht also nicht aus, den Widerspruch erst nach einem Monat zu schreiben und dann bei der Behörde abzugeben. Das wäre zu spät und der Widerspruch muss dann allein wegen der abgelaufenen Frist zurückgewiesen werden.

- Beispiel: Der auf den 02.02. datierte Bescheid, mit dem die beantragte Grundsicherung abgelehnt wird, liegt am 10.02. (Montag) im Briefkasten der Antragstellerin. Diese holt den Bescheid am 13.02. (Donnerstag) aus dem Briefkasten und liest ihn am 15.02. (Samstag). Wann beginnt die Widerspruchsfrist zu laufen und wann endet sie?
- Erklärung: Der Bescheid wurde am 10.02. bekanntgegeben. Die Widerspruchsfrist beginnt daher am 11.02. zu laufen, also einen Tag nach der Bekanntgabe. Demzufolge muss der Widerspruch bis spätestens zum 10.03. bis 23.59 Uhr bei der Behörde eingegangen sein.
- Hinweis: Endet die Monatsfrist am Samstag, Sonntag oder einem gesetzlichen (bundeseinheitlichen) Feiertag, so verschiebt sich das Fristende in den meisten Fällen auf den darauffolgenden Werktag. Im Unterschied dazu kann der Beginn der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fallen!
- Beachte: Wer am letzten Tag des Fristenlaufs zu später Stunde den Widerspruch in den Briefkasten der Behörde werfen möchte, geht das Risiko ein, dass die Behörde über keinen Nachtbriefkasten mit Stempelung des Einwurfs verfügt. Dann kann es passieren, dass die Behörde von einem am 11.03. – also verspätet – eingelegten Widerspruch ausgeht.
- Tipp: Den Widerspruch nicht erst am Ende der Frist "auf den letzten Drücker“ einreichen. Besser erst einmal nur fristwahrend (also ohne Begründung) Widerspruch einlegen und die Begründung später nachreichen (mehr dazu unten im Text). Lassen Sie sich bei später Einlegung des Widerspruchs beraten, ob die Frist richtig berechnet wurde.
Weitere Informationen zur Bekanntgabe eines Bescheids
Weil sich der oben genannte Zeitpunkt der Bekanntgabe nicht immer exakt feststellen lässt, gilt bei einer Versendung des Bescheids als einfacher Brief: Der Bescheid gilt am vierten Tag nach der Aufgabe bei der Post als bekanntgegeben, wenn er nicht später oder gar nicht zugegangen ist (gesetzliche Vermutung nach § 37 Abs. 2 SGB X).
Wichtig: Kommt kein Bescheid an, wurde der Bescheid auch nicht “bekanntgegeben”. Das heißt, es läuft auch keine Widerspruchsfrist.
Im Streitfall muss die Behörde den Zugang des Bescheids und das Datum des Zugangs nachweisen. Dieser Nachweis ist bei einfachen Briefsendungen nur schwer zu führen. So reicht z. B. ein sogenannter Ab-Vermerk nicht aus, der vom zuständigen Sachbearbeiter in der Akte angebracht wird. Das wird von den Gerichten immer wieder betont. Meistens weiß die Empfängerin bzw. der Empfänger des Bescheids nicht, wann der Bescheid bei der Post aufgegeben wurde. Das muss dann erst geklärt werden.
Was kann ich tun, wenn ich die Widerspruchsfrist verpasst habe?
Ist der Widerspruch zu spät eingereicht und der Bescheid bestandskräftig (also wirksam) geworden, dann kann der Widerspruch in der Regel keinen Erfolg mehr haben.
Möglichkeiten nach Fristende
Sehr praxisrelevant ist die besondere Möglichkeit im Sozialrecht, auch einen bestandskräftigen Bescheid überprüfen zu lassen.
Erläuterung: Bestandskräftig ist ein Bescheid, gegen den kein Widerspruch eingelegt wurde, wenn inzwischen die Widerspruchsfrist abgelaufen ist.
Das geschieht im Rahmen des sogenannten Zugunsten-Verfahrens bzw. Überprüfungsantrags. Die Behörde erhält hierdurch die Gelegenheit, eigene Fehlentscheidungen zu korrigieren. Das bedeutet: Wenn die Widerspruchsfrist versäumt wurde, können Sie bei der Behörde einen Antrag auf Überprüfung nach § 44 Sozialgesetzbuch 10 (SGB X) stellen.
Bei der Überprüfung kann festgestellt werden, dass die Ablehnung falsch war und die Leistung zu bewilligen ist. Dann bleibt noch zu klären: Wie lange rückwirkend werden die Leistungen erbracht?
- Beispiel: B hat die Widerspruchsfrist gegen den ablehnenden Bescheid des Sozialamts verstreichen lassen und keinen Widerspruch eingelegt. Als ihm das – zu spät – bewusst wird, stellt er einen Überprüfungsantrag. Daraufhin stellt die Behörde fest, dass die Ablehnung tatsächlich rechtswidrig war und bewilligt (nun doch) die begehrte Leistung.
- Die nachträglichen Leistungen nach dem SGB XII kommen maximal für ein Jahr in Betracht (vgl. § 116a Nr. 2 SGB XII in Verbindung mit § 44 Abs. 4 SGB X). A kann rückwirkend also maximal Leistungen für ein Jahr geltend machen. Das gilt aber nur für die Leistungen der Sozialhilfe.
Wurde die Frist unverschuldet versäumt, kann ein sogenannter “Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand” gestellt werden (§ 27 SGB X). Wird dem Antrag stattgegeben, dann wird der verspätete Widerspruch so behandelt, als sei die Frist nicht versäumt worden.
- Zu Beispiel 1: A möchte 1 Woche vor Ablauf der Widerspruchsfrist noch Widerspruch einlegen. Nach einem schweren Unfall kommt A jedoch ins Krankenhaus und denkt nicht mehr daran, dass die Frist bald abläuft. In diesem Fall könnte der später gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand dazu führen, dass A so gestellt wird, als hätte er die Frist nicht versäumt.
Als unverschuldete Fristversäumnis gilt auch das Fehlen der erforderlichen Begründung einer Ablehnung oder eine unterbliebene Anhörung der antragstellenden Person (§ 41 Abs. 3 SGB X).
Muss der Widerspruch begründet werden?

Zu Beispiel 2: A fragt sich, ob er den Widerspruch begründen muss.
Nein, der Widerspruch muss nicht begründet werden. Allerdings ist eine Begründung sehr ratsam! Denn nur so erfährt z. B. der Träger der Eingliederungshilfe, die Pflegeversicherung oder die Krankenkasse, warum jemand mit der Ablehnung nicht einverstanden ist. In diesem Zusammenhang kann es hilfreich sein, Akteneinsicht zu verlangen. Dann können Sie vielleicht erkennen, warum die Behörde Ihren Antrag abgelehnt hat und in Ihrer Begründung darauf eingehen.
Wichtig: Ohne Begründung hat Ihr Widerspruch kaum Aussicht auf Erfolg. Die Begründung kann aber auch nachgereicht werden, sie muss nicht zeitgleich mit dem Widerspruch zusammen abgegeben werden! Fazit: Auch wenn sie Mühe macht: Reichen Sie unbedingt eine Begründung ein (oder nach). Reichen Sie ggf. Unterlagen ein, die Sie Ihrem Antrag noch nicht beigefügt hatten, die aber relevant sein könnten (z. B. Arztberichte).
Die Begründung ist oft schwierig, weil sie mit tatsächlichen und/oder rechtlichen Fragen verbunden ist. Auch deshalb kann es sinnvoll sein, den Widerspruch zunächst fristwahrend (ohne Begründung) einzulegen, um Zeit für eine gute Begründung zu gewinnen. Hier ein Vorschlag, wie Sie vorgehen könnten.
Wie man seinen Widerspruch begründet
Informieren Sie sich über die Leistung, die Sie beantragt haben: Unter welchen Voraussetzungen wird sie bewilligt? Schauen Sie hierfür gern auf unseren Internetseiten nach wie z. B.:
Lesen Sie sich den ablehnenden Bescheid durch:
- Mit welcher Begründung lehnt die Behörde Ihren Antrag ab?
- Achten Sie auf das Argument der Behörde und vergleichen es mit den Informationen, die Sie gefunden haben.
- Machen Sie in der Widerspruchsbegründung konkrete Angaben dazu, warum der Anspruch Ihnen zusteht und die Ablehnung falsch ist.
- Lassen Sie sich helfen:
- von einer Rechtsanwältin, einem Rechtsanwalt bzw. einer Rechtsberatung in Ihrer Nähe
- von der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) – hier ist allerdings zu beachten, dass die EUTB leider nur allgemein über die Rechtslage informieren darf. Die EUTB ist nicht berechtigt, Sie in Ihrem konkreten Einzelfall zu beraten und im Widerspruchsverfahren zu begleiten. Das bedeutet, die EUTB darf auch nicht bei der Begründung des Widerspruchs helfen!
- von den Juristen in Sozialverbänden
- von der Verbraucherzentrale
Beispiel: Widersprüche mit Begründungen
Es folgen nun Beispiele für Widersprüche mit Begründungen – sie dienen aber nur als Vorlage, die an den konkreten Einzelfall anzupassen sind und keinesfalls so übernommen werden sollten! Je sorgfältiger und konkreter Sie den Widerspruch begründen, desto höher die Erfolgsaussichten. Bitte bedenken Sie, dass die Details sehr entscheidend sein können.
Das Sozialamt lehnt den Antrag auf Grundsicherung ab, weil Ihr Vermögen sich auf 12.000 Euro beläuft. Das heißt, dass Sie also mit einem Betrag in Höhe von 2.000 Euro oberhalb des Schonbetrags von 10.000 Euro liegen.
- Wenn Sie sich informieren oder beraten lassen, werden Sie feststellen, dass Sterbegeldversicherungen unter bestimmten Voraussetzungen nicht als Vermögen angerechnet werden dürfen (Härtefall). Es ist also möglich, dass das Sozialamt zu Unrecht Ihre Sterbegeldversicherung als Vermögen berücksichtigt hat (Wert z. B.: 4.000 Euro).
- Wenn man daher von den 12.000 Euro, die das Sozialamt als Vermögen ansieht, den oben genannten Wert der Versicherung abzieht, bleibt nur noch ein Vermögen in Höhe von 8.000 Euro übrig. Dann übersteigt Ihr Vermögen nicht mehr den Schonbetrag von 10.000.
- Das Argument der Behörde ist damit entkräftet und die Ablehnung des Antrags ungerechtfertigt.
Beispiel für eine Widerspruchsbegründung, wenn der Antrag auf Grundsicherung unter Hinweis auf den hohen Verdienst eines Elternteils abgelehnt wurde.
(Auf den Text zur Widerspruchseinlegung – siehe dazu die Musterwidersprüche unten – folgt für Ihr erwachsenes Kind die folgende Begründung.)
Begründung:
Der Anspruch meines erwachsenen Kindes ist im Sozialgesetzbuch 12 (SGB XII) geregelt. Die Voraussetzungen für den Anspruch sind gegeben; deshalb war die Ablehnung auch rechtswidrig: Mein Kind ist XXX (mindestens 18) Jahre alt und hat seinen Lebensmittelpunkt im Inland. Es ist dauerhaft und voll erwerbsgemindert. Das hat die Deutsche Rentenversicherung (DRV) festgestellt (Anlage: Bescheid der DRV). Außerdem hat mein Kind nicht genug eigenes Einkommen und Vermögen, um seine Bedarfe zu decken. Das Geld, das es in der WfbM verdient, reicht hierfür nicht aus.
Das Vermögen der Eltern zählt nicht mit. Auch mein Einkommen und das meines Mannes stehen einem Anspruch unseres Kindes auf Grundsicherung nicht entgegen. Mein Mann verdient zwar mehr als 100.000 Euro jährlich brutto, aber das lässt den Anspruch auf Grundsicherung nicht entfallen. Früher war es so, dass der Anspruch auf Grundsicherung entfiel, wenn ein Elternteil so viel Geld im Jahr verdiente (§ 43 Absatz 2 SGB XII alte Fassung – die inzwischen aufgehoben wurde). Seit 2017 ist das aber nicht mehr so. Der hohe Verdienst meines Mannes führt nur dazu, dass wir als Eltern einen monatlichen Beitrag an den Träger der Sozialhilfe zahlen müssen (§ 94 Abs. 2 SGB XII). Das ist auch richtig so, denn die Grundsicherung ist dazu da, dass auch junge Menschen mit Behinderung sich finanziell von den Eltern „abnabeln“ können. Das muss auch für junge Menschen gelten, deren Eltern besonders viel Geld verdienen.
Aus diesem Grund ist die Ablehnung aufzuheben und meinem erwachsenen Kind die beantragte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu gewähren.
Hinweis: Falls Sie dieses Beispiel als Vorlage nutzen möchten, passen Sie es bitte auf Ihren speziellen Fall an.
Beispiel für eine Widerspruchsbegründung, wenn ein Mensch ambulant versorgt wird und die Leistung der Eingliederungshilfe unter Hinweis auf die Leistungen der Pflegeversicherung abgelehnt wurde.
(Auf den Text zur Widerspruchseinlegung – siehe dazu die Musterwidersprüche unten – folgt für Ihr erwachsenes Kind die folgende Begründung.)
Begründung:
Es war rechtswidrig, die beantragte Eingliederungshilfe abzulehnen. Die Leistungen der Pflegeversicherung sind nicht vorrangig. Der Anspruch meines Kindes auf Leistungen der Eingliederungshilfe ist im SGB IX geregelt, und meine Tochter/mein Sohn gehört zum leistungsberechtigten Personenkreis (eventuell weiter ausführen, dass Ihr Kind eine sogenannte geistige Behinderung hat).
Im Gesetz steht ausdrücklich, dass Eingliederungshilfe und Pflege unterschiedliche Zielrichtungen haben und deshalb nebeneinander geltend gemacht werden können (§ 91 Abs. 3 SGB IX, § 13 Abs. 3 SGB XI). Bei der Pflege geht es vor allem um die Aufrechterhaltung bzw. Wiedergewinnung von verloren gegangenen Fähigkeiten und der Selbstständigkeit. Gesundheitliche Beeinträchtigungen sollen kompensiert werden (§ 2 SGB XI). Dagegen ist es Ziel der Eingliederungshilfe, dem Menschen eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen und die volle Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.
Der Gesetzgeber hat auch mit der Regelung des § 13 Abs. 4 SGB XI deutlich gemacht, dass er den gleichzeitigen Bezug beider Leistungen für möglich hält. Danach soll bei Anhaltspunkten für einen Bedarf an beiden Leistungen (Eingliederungshilfe und Pflege) ggf. eine Vereinbarung zwischen Pflegeversicherung und Träger der Eingliederungshilfe geschlossen werden.
Mein Kind hat den Pflegegrad XXX und benötigt die Leistungen der Pflegeversicherung für seine pflegerische Versorgung … (ggf. weitere Ausführungen). Diese Leistungen können nicht für die ebenfalls benötigte Unterstützung für ein möglichst selbstbestimmtes Leben verwendet werden. Vielmehr braucht mein Kind daneben – ergänzend – auch noch die Leistungen Eingliederungshilfe ... (weiter ausführen).
Es handelt sich also nicht um eine unzulässige Doppeltleistung, wenn mein Kind Leistungen der Eingliederungshilfe beansprucht und für die pflegerischen Bedarfe die Leistungen der Pflegeversicherung abrufen möchte. Menschen mit Behinderung benötigen häufig beide Leistungen, um selbstbestimmt leben zu können. Dies dürfte inzwischen allgemein bekannt sein.
Auch die Gerichte entscheiden regelmäßig, dass die Leistungen bei der häuslichen Versorgung nebeneinander beansprucht werden können. Aus diesem Grund ist der ablehnende Bescheid aufzuheben und die Leistung der Eingliederungshilfe antragsgemäß zu gewähren.
Hinweis: Falls Sie dieses Beispiel als Vorlage nutzen möchten, passen Sie es bitte auf Ihren speziellen Fall an.
Wie lange dauert es, bis die Behörde über meinen Widerspruch entscheidet?

Zu Beispiel 3: Nach monatelangem Warten fragt sich A, wann nun endlich über seinen Widerspruch entschieden wird. Kann er etwas unternehmen, um die Bearbeitung zu beschleunigen?
Eine häufig gestellte Frage: Welche Bearbeitungszeit hat die Behörde bzw. wie lange hat sie Zeit, über den Widerspruch zu entscheiden? Anders ausgedrückt: Wie lange müssen Sie auf die Entscheidung warten, nachdem Widerspruch eingelegt wurde? Und was können Sie tun, wenn die Behörde monatelang nicht entscheidet?
- Die Behörde muss spätestens nach drei Monaten über den Widerspruch entscheiden (§ 88 Abs. 2 Sozialgerichtsgesetz / SGG). Tut sie dies nicht, sollte über eine Untätigkeitsklage nachgedacht und diese Absicht der Behörde mitgeteilt werden. Es kommt vor, dass dann allein aufgrund dieser Ankündigung sehr zeitnah entschieden wird.
- Zu Beispiel 3: A – der schon länger als drei Monate gewartet hat – ist zu raten, dem Leistungsträger in einem Brief oder einer Mail anzukündigen, dass er sich zu einer Untätigkeitsklage beraten lassen wird. Bevor er tatsächlich Untätigkeitsklage erhebt, sollte A sich erkundigen, ob womöglich Gründe vorliegen, die die lange Bearbeitungsdauer entschuldigen. Siehe dazu die folgenden weiteren Informationen:
- Entschuldigt die Behörde ihre Untätigkeit, die über drei Monate hinausgeht, mit Personalmangel oder beruft sich auf einen ähnlichen Grund, dann gilt nach dem Sozialgericht Detmold (Urteil vom 18.04.2023 – Az: S 35 SO 138/22, Rechtsdienst der Lebenshilfe 3/2023, S. 144 f.):
- Hat die Behörde einen “zureichenden Grund” für ihre Untätigkeit, dann ist die Nichtentscheidung über den Widerspruch zunächst entschuldigt. Dann hätte eine Untätigkeitsklage keine Aussicht auf Erfolg. Allerdings, so das SG Detmold, könne ein solcher Grund nur ausnahmsweise angenommen werden, wenn die Behörde aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls objektiv an der fristgerechten Bescheidung gehindert war. So könnten ein kurzfristig stark erhöhtes Arbeitsaufkommen oder eine vorübergehende besondere Belastung einen zureichenden Grund darstellen. Allerdings müsse die Behörde in diesem Fall dezidiert nachweisen, dass sie alles unternommen habe, um eine Verfahrensverzögerung zu vermeiden. Dagegen sei eine dauerhafte, ggf. schon seit Jahren anhaltende mangelhafte Personalausstattung kein hinreichender Grund. Im Hinblick auf den effektiven Rechtsschutz müsse die Behörde sich so organisieren, dass grundsätzlich eine fristgerechte Entscheidung über den Widerspruch gewährleistet sei. Ob andere Sozialgerichte genauso entscheiden würden, kann nicht gesagt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass hierzu auch eine andere Auffassung vertreten wird.
- Beachte: Vor der Erhebung der Untätigkeitsklage sollte bei der Behörde nachgefragt werden, warum die Entscheidung so lange dauert. Eine grundsätzliche Nachfragepflicht gibt es zwar nicht, im Einzelfall kann sie aber notwendig sein, damit die Untätigkeitsklage erhoben werden darf (vgl. Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 08.02.2023 – Az: 1 BvR 311/22, Rechtsdienst der Lebenshilfe 3/2023, S. 144 f.).
- Tipp: Entscheidet die Behörde lange nicht über den Widerspruch, kommt unter Umständen eine Selbstbeschaffung der begehrten Leistung in Betracht (vgl. dazu Recht auf Teilhabe, 7. Aufl., 2023, S. 361 f.).
- Entschuldigt die Behörde ihre Untätigkeit, die über drei Monate hinausgeht, mit Personalmangel oder beruft sich auf einen ähnlichen Grund, dann gilt nach dem Sozialgericht Detmold (Urteil vom 18.04.2023 – Az: S 35 SO 138/22, Rechtsdienst der Lebenshilfe 3/2023, S. 144 f.):
Welche Reaktionen auf den Widerspruch sind möglich?
In § 85 SGG ist geregelt, wie die Entscheidung über den Widerspruch aussehen kann:
- Im positiven Fall hebt die Behörde ihre Ablehnung auf und bewilligt die begehrte Leistung.
- Bei einer teilweisen Bewilligung – aufgrund Ihres Widerspruchs - ist zu überlegen, ob im Hinblick auf die teilweise bestehen gebliebene Ablehnung Klage eingereicht werden sollte.
- Im negativen Fall hält die Behörde vollständig an Ihrer Ablehnung fest und weist den Widerspruch zurück. Dann bekommen Sie einen sogenannten Widerspruchsbescheid. Ab Erhalt des Widerspruchsbescheids haben Sie einen Monat Zeit, um eine Klage gegen die Ablehnung einzureichen.
Die Kosten im Widerspruchsverfahren
Kostet es etwas, Widerspruch einzulegen?
Für die Tätigkeit der Behörde fallen keine Kosten für einen Widerspruch an. Das steht in § 64 Sozialgesetzbuch X (SGB X). Man muss also nichts bezahlen, egal ob man erfolglos oder erfolgreich Widerspruch eingelegt hat. Man muss auch nichts bezahlen, wenn man den Widerspruch zurückgenommen hat. Das gilt aber nur im Sozialrecht, also im Zusammenhang mit Leistungen der Krankenkasse, Pflegeversicherung, der Eingliederungshilfe, Rentenversicherung usw.
Kosten können allerdings dafür entstehen, dass die Person, die Widerspruch einlegt, einen Anwalt beauftragt und die Kosten hierfür nicht von einer Rechtsschutzversicherung oder als Beratungshilfe gedeckt oder als notwendig erstattet werden (mehr dazu weiter unten).
Die Kostenfreiheit schließt auch mögliche Dolmetscherkosten ein. Für Menschen mit Hör- und Sprachbehinderungen ist dies ausdrücklich geregelt (§ 17 Abs. 2 Satz 2 SGB I, § 19 Abs. 1 Satz 2 SGB X). Das gilt aber nur für Widersprüche gegen sozialrechtliche Bescheide, also Entscheidungen der Behörde zu Sozialleistungen.
Kann ich Beratungshilfe für die Widerspruchsbegründung bekommen?

Die Beratungshilfe ist eine finanzielle Unterstützung durch den Staat, um sich rechtlich z. B. von einem Rechtsanwalt bzw. einer Rechtsanwältin beraten und ggf. auch vertreten zu lassen, wenn noch kein Gerichtsverfahren anhängig ist.
Zu Beispiel 2: A kann für die Widerspruchsbegründung Beratungshilfe bewilligt bekommen. Dann muss A nur noch 15 Euro an die Anwältin oder den Anwalt zahlen, sofern die persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen (wie vor allem die Bedürftigkeit) für die Beratungshilfe vorliegen.
Für die Beratung im Widerspruchsverfahren kommt es darauf an:
- Wird die anwaltliche Hilfe benötigt, um den Widerspruch gut begründen zu können?
- Würde jemand, der die Unterstützung (z. B. durch einen Rechtsanwalt) selbst bezahlen müsste, das Geld dafür ausgeben?
Wenn diese Fragen bejaht werden können, muss A die Beratungshilfe vom Amtsgericht gewährt werden.
Die Ablehnung der beantragten Beratungshilfe bedarf immer einer einzelfallbezogenen Begründung. Weitere Informationen finden Sie im Recht auf Teilhabe (7. Auflage, S. 368 ff.).
Werden Kosten für eine anwaltliche Beratung im Widerspruchsverfahren
erstattet?
Wenn der Widerspruch erfolgreich war, kann unter Umständen eine Erstattung der “notwendigen Kosten” geltend gemacht werden, z. B. für eine anwaltliche Beratung, die man selbst bezahlt hat (vgl. § 63 SGB X: § 63 SGB X – Einzelnorm).
Hinweis: Kosten, die durch Verschulden der Person entstanden sind, die Widerspruch eingelegt hat, werden allerdings nicht übernommen.
Dementsprechend lehnte das SG Chemnitz (Urteil vom 17.04.2025 – S 22 KG 8/23) eine Klage auf Kostenerstattung ab: Der Antrag der Klägerin auf Kindergeld war mangels Mitwirkung abgelehnt worden. Erst im Widerspruchsverfahren legte die Klägerin die nötigen Unterlagen zum Nachweis der Kindergeldberechtigung vor. Es war daher ihr Verschulden, dass es überhaupt zu einer Ablehnung gekommen war. Aus diesem Grund waren die Kosten für die Unterstützung im Widerspruchsverfahren nicht notwendig und nicht zu erstatten.
(Vgl. zur Kostenerstattung in Angelegenheiten der privaten Pflegeversicherung BSG, Urteil vom 22.02.2024 – Az. B 3 P 8/22, Rechtsdienst der Lebenshilfe 3/2024, S. 146 (Anspruch bejaht).)
Musterwidersprüche
Diese Musterwidersprüche können Sie gerne als Vorlage nutzen. Bitte bearbeiten Sie die Vorlagen aber entsprechend und holen Sie sich im Zweifel Unterstützung.
Zu den Musterwidersprüchen
Name und Adresse
Zuständige Behörde
Ort, Datum
Betreff: Widerspruch in Sachen A (ihr Name) gegen den Bescheid des Landratsamtes XXX (Stelle angeben, die den Bescheid erlassen hat) – Geschäftszeichen: XXX (entsprechendes Geschäftszeichen eintragen)
Hiermit lege ich gegen den oben genannten Bescheid des XXX (Stelle angeben), zugegangen am XXX (Zugangsdatum angeben), Widerspruch ein. Die Begründung des Widerspruchs reiche ich umgehend nach.
Mit freundlichen Grüßen
XXX (persönliche Unterschrift des Menschen mit Behinderung oder des gesetzlichen Vertreters)
Name und Adresse
Zuständige Behörde
Ort, Datum
Betreff: Widerspruch in Sachen A (ihr Name) gegen den Bescheid des Landratsamtes XXX (Stelle angeben, die den Bescheid erlassen hat) – Geschäftszeichen: XXX
Hiermit lege ich gegen den oben genannten Bescheid des XXX (Stelle angeben), zugegangen am XXX (Zugangsdatum angeben), Widerspruch ein.
Begründung: Die Ablehnung der beantragten Leistung ist rechtswidrig. Es steht mir ein Anspruch auf XXX zu. (Beispiele: Anspruch auf das Merkzeichen H, auf Leistungen der Eingliederungshilfe oder Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Hier möglichst konkret bezeichnen.)
(Hinweis: Hier folgt die weitere Begründung, die möglichst detailliert und ausführlich erklären sollte, warum der Anspruch in Ihrem speziellen Fall gegeben ist. Siehe oben.)
Mit freundlichen Grüßen
XXX (persönliche Unterschrift des Menschen mit Behinderung oder des gesetzlichen Vertreters)



